 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
Thema: Der logische Fehler im Gottesbeweis des Thomas von Aquin |
Referent: Johannes Wienand |
Dozent: Clemens Weidmann |
Sommersemester 2001 |
Universität Wien |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
Der dritte Gottesbeweis des Thomas von Aquin.
(lateinisches Original) |
|
 |
 |
 |
Tertia via est
sumpta ex possibili et necessario: quae talis est.
Invenimus enim in rebus quaedam quae sunt possibilia esse et non esse:
cum quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens
possibilia esse et non esse. Impossibile est autem omnia quae sunt
talia [semper] esse: quia quod possibile est non esse, quandoque non est.
Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus.
Sed si hoc est verum, etiam nunc nihil esset: quia quod non est,
non incipit esse nisi per aliquid inciperet esse, et sicmodo nihil esset:
quod patet esse falsum. Non ergo omnia entia sunt possibilia:
sed oportet aliquid esse necessarium in rebus.
Omne autem necessarium vel habet causam suae necessitatis aliunde,
vel non habet. Non est autem possibile quod procedatur in infinitum
sicut nec in causis efficientibus, ut probatum est. Ergo necesse est
ponere aliquid quod sit per se necessarium, non habens causam
necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis:
quod omnes dicunt Deum. |
|
|
 |
|
|
|
 |
Der dritte Gottesbeweis des Thomas von Aquin
(deutsche Übersetzung) |
|
 |
 |
 |
| Der dritte Weg zur Erkenntnis Gottes geht von den Begriffen des Möglichen und des Notwendigen aus
und verläuft wie folgt: |
(a)
 |
Wir finden unter den Dingen nämlich solche,
deren Existenz wie deren Nichtexistenz gleichermaßen möglich ist,
da sie irgendwann entstehen und wieder vergehen. Für alle diese Dinge ist es
unmöglich, ewig zu existieren, weil etwas, dessen Nicht-Existenz möglich ist,
auch zu irgendeiner Zeit nicht existiert.
Wenn aber für schlechthin alles zutreffen sollte,
dass seine Nicht-Existenz möglich ist, dann muss es auch eine Zeit gegeben haben,
in der tatsächlich nichts existierte.
Wenn das aber der Fall wäre, dann würde auch heute nichts existieren; denn etwas,
das nicht existiert, beginnt nur durch etwas anderes zu existieren, das seinerseits schon
existiert. Wenn also irgendwann einmal nichts existierte, dann konnte auch nichts
zu existieren beginnen, und es würde zu keiner Zeit etwas existieren. Dies ist aber
offensichtlich falsch. Deshalb sind nicht alle Dinge in ihrer Existenz nur möglich;
es muss irgend etwas geben, dessen Existenz notwendig ist. |
| (b) |
Jedes Notwendige hat aber die Ursache seiner Notwendigkeit entweder von
anderswoher oder nicht. Es ist aber nicht möglich,
dass es ins Unendliche bei den notwendigen Dingen gehe, die eine Ursache
ihrer Notwendigkeit haben, wie dies auch bei den Wirkursachen nicht möglich ist, wie oben
bewiesen. |
| (c) |
Also ist es notwendig etwas anzunehmen, das an sich notwendig ist und die Ursache seiner
Notwendigkeit nicht von anderswoher hat, sondern das vielmehr Ursache der Notwendigkeit für die
anderen Dinge ist. |
|
Dies nennen alle Gott. |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
Formalisierung der natürlichen Sprache |
|
 |
 |
 |
Die formale Logik versucht nun ein System zu entwickeln, in dem Sätze völlig ohne die
in einer natürlichen Sprache üblichen Ungenauigkeiten ausgesagt werden können. Dazu wird eine
stark formalisierte eigene Sprache entwickelt: die logische Sprache. Ein Satz der natürlichen
Sprache wird nun in seine Bestandteile zerlegt und analysiert. Subjekte werden durch Individuenkonstanten (a, b, c, ...)
oder Individuenvariablen ersetzt (x, y, z, ...), Prädikate durch Prädikatbuchstaben (A, B, C, ...).
Das obige Beispiel könnte nun wie folgt formuliert werden:
Beispiel für ein gültiges Argument mit zwei Prämissen:
| 1. Für alle x gilt, wenn x die Eigenschaft M hat (nämlich die Eigenschaft, ein Mensch zu sein), dann hat x ebenfalls die Eigenschaft S (nämlich die Eigenschaft, sterblich zu sein). |
 |
 |
Erste Prämisse |
| 2. Es gibt mindestens ein a. Dieses a hat die Eigenschaft A (nämlich Aristoteles zu heißen) und dieses a hat ebenfalls die Eigenschaft M (nämlich ein Mensch zu sein). |
 |
 |
Zweite Prämisse |
 |
| 3. Also: Es gibt mindestens ein a. Dieses a hat die Eigenschaft A (nämlich Aristoteles zu heißen) und dieses a hat ebenfalls die
Eigenschaft S (nämlich sterblich zu sein). |
 |
 |
Konklusion |
Dieses Argument kann wie folgt vereinfacht werden:
| 1. Für alle x gilt: wenn Mx dann Sx. |
 |
 |
Erste Prämisse |
| 2. Es gibt mindestens ein a für das gilt: Aa und Ma. |
 |
 |
Zweite Prämisse |
 |
| 3. Also: Es gibt mindestens ein a für das gilt: Aa und Sa. |
 |
 |
Konklusion |
Diese formalisierte Fassung des Satzes lässt die grammatische Struktur der Aussage wesentlich
deutlicher erkennen, als die umgangssprachliche Formulierung. Die Aussagen können aber noch weiter
analysiert werden, indem man die Bedeutung der oben unterstrichen dargestellten Satzteile analysiert. |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
Sportwagen und Millionäre |
|
 |
 |
 |
Um den logischen Fehler im
dritten Gottesbeweis des Thomas von Aquin als einen solchen zu entdecken, benötigt man
nun keine weiteren Kenntnisse der formalen klassischen Logik. Dennoch sind einige
Vorüberlegungen und ein Minimum an Mengenlehre nötig, um den Fehler richtig zu interpretieren.
Doch zunächst bleiben wir noch bei Sätzen der natürlichen Sprache.
Schauen wir uns folgendes Beispiel an:
1. Jeder Millionär besitzt (mindestens) einen Sportwagen.
Dieser Satz sagt folgendes aus:
(a) Es gibt eine Menge von Millionären. Diese Menge ist nicht leer, das heißt,
sie enthält mindestens ein Element, nämlich
mindestens einen Millionär.
(b) Es gibt eine Menge von Sportwagen. Auch diese Menge ist nicht leer, das heißt,
sie enthält mindestens ein Element, in diesem
Fall mindestens einen Sportwagen.
(c) Jedes Element der Menge M (also jeder Millionär), steht in
einer bestimmten Relation (nämlich in einem
Besitzverhältnis) zu einem Element der Menge S (also zu einem Sportwagen).
Der Satz besagt, dass die verschiedenen Millionäre durchaus auch
verschiedene Sportwagen besitzen können. Es ist lediglich
vorgegeben, dass jeder Millionär (mindestens) einen Sportwagen besitzt - welchen ist dabei völlig egal.
Schauen wir uns einen zweiten Satz an, den man auf den ersten Blick
als die Umkehrung des Satzes 1 betrachten könnte:
2. Es gibt (mindestens) einen Sportwagen, den jeder Millionär besitzt.
Dieser Satz besagt im Gegensatz zu Satz 1, dass jeder Millionär
(mindestens) ein und den selben Sportwagen besitzt (mindestens bedeutet hier, dass er darüber
hinaus noch andere Sportwagen besitzen kann, dass aber mindestens dieser eine bestimmte Sportwagen
darunter sein muss).
Dieser kleine, aber feine Unterschied ist in der deutschen Sprache nicht auf Anhieb erkennbar.
Formalisiert man jedoch die beiden Sätze mithilfe der formalen Logik,
wird schnell deutlich, dass es sich bei den beiden
Sätzen um zwei grundverschiedene Bedeutungen handelt:
| 1. |
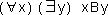 |
| 2. |
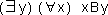 |
|
Zeichenerklärung:
x ist ein Element der Menge der Millionäre
y ist ein Element der Menge der Sportwagen
B ist die Relation zwischen x und y, in diesem Fall das
Besitzverhältnis. |
Aussage 1 besagt, dass jeder Millionär den einen oder anderen Sportwagen besitzt.
Es kann also der eine einen Porsche fahren, der andere einen Ferrari etc. Wichtig ist
nur, dass jeder Millionär irgendeinen Sportwagen sein eigen nennen kann.
Die Aussage 2 hingegen behauptet, dass es einen ganz bestimmten Sportwagen gibt
(zum Beispiel einen Ferrari), den alle Millionäre besitzen. Jeder Millionär hätte
somit also einen Ferrari in der Garage stehen.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
Der logische Fehler bei Thomas von Aquin |
|
 |
 |
 |
Der Fehler, den
Thomas von Aquin in seinem dritten Gottesbeweis macht, ist von der selben Art
wie der obige Fehler mit den Sportwagen und den Millionären. Die fragliche Textstelle
ist folgende:
1. Für alle diese Dinge ist es
unmöglich, ewig zu existieren, weil etwas, dessen Nicht-Existenz möglich ist,
auch zu irgendeiner Zeit nicht existiert.
2. Wenn aber für schlechthin alles zutreffen sollte,
dass seine Nicht-Existenz möglich ist, dann muss es auch eine Zeit gegeben haben,
in der tatsächlich nichts existierte.
Um den Fehlschluss zu verdeutlichen, muss diese Textstelle wieder genau analysiert und
formalisiert werden. Auf diese Art und Weise erhält man folgende Sätze:
| 1. |
Für jedes Ding gibt es (mindestens) einen Zeitpunkt, zu dem es nicht existiert. |
| 2. |
Es gibt (mindestens) einen Zeitpunkt, zu dem jedes Ding nicht existiert. |
| Satz 2. lässt sich wie folgt umschreiben: |
| 2a) |
Es gibt (mindestens) einen Zeitpunkt, zu dem kein Ding existiert. |
Formalisiert sieht das Argument dann wie folgt aus:
| 1. |
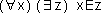 |
| 2. |
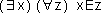 |
|
Zeichenerklärung:
x ist ein Element der Menge der Dinge (also ein Ding)
z ist ein Element der Menge der Zeitpunkte (also ein Zeitpunkt)
E ist die Relation zwischen x und z und besagt in diesem Fall, dass
x zum Zeitpunkt z nicht existiert. |
Jetzt wird deutlich, dass Thomas von Aquin eine in der Logik unzulässige Umformung
vorgenommen hat. Die Wahrheit einer Aussage darf verständlicherweise unter einer formalen
Transformation nicht leiden. Doch eben dies tut sie hier. Während im Satz 1 jedem Ding
mindestens ein bestimmter Zeitpunkt zukommt, an dem es nicht existiert - es können ohne weiteres
für jedes Ding verschiedene Zeitpunkte sein - gibt es im Satz 2 mindestens einen bestimmten
Zeitpunkt, an dem kein einziges Ding existiert.
Wie somit gezeigt werden konnte, ist der dritte Gottesbeweis des Thomas von
Aquin formallogisch ungültig. |
|
|
 |
|
| --> [ jo ] |